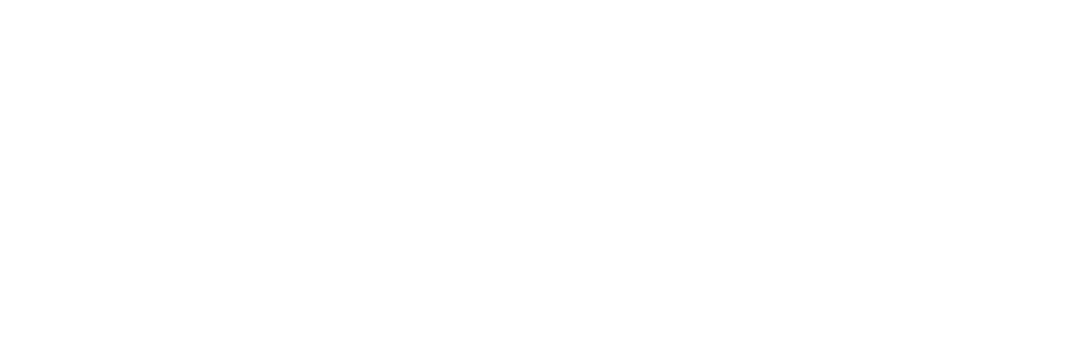Wie die deutsche Wasserstoffwirtschaft den Weg zur CO2-Neutralität ebnet
Deutschland hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: bis 2045 klimaneutral zu werden. Ein zentraler Baustein auf diesem Weg ist grüner Wasserstoff – hergestellt aus erneuerbaren Energien. Doch wie gelingt der Aufbau einer funktionierenden Wasserstoffwirtschaft? Dieser Artikel zeigt, wo Deutschland steht, welche Herausforderungen es gibt und wie die Zukunft aussehen könnte.
Die Nationale Wasserstoffstrategie: Ein Fahrplan für die Zukunft
Die Bundesregierung hat mit der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) einen klaren Rahmen geschaffen. Die 2023 aktualisierte Strategie verfolgt drei Ziele:
- Ausreichende Verfügbarkeit von klimaneutralem Wasserstoff bis 2030.
- Aufbau einer leistungsfähigen Infrastruktur.
- Förderung von Wasserstoffanwendungen in Industrie und Verkehr.
Konkret plant Deutschland bis 2030:
- 10 Gigawatt (GW) Elektrolysekapazität für grünen Wasserstoff.
- 50–70 % des Wasserstoffbedarfs durch Importe zu decken.
Tabelle 1: Ziele der Nationalen Wasserstoffstrategie
| Kennzahl | Ziel 2030 |
| Elektrolysekapazität | 10 GW |
| Wasserstoffbedarf | 95–130 TWh |
| Eigenproduktion | 30–50 % |
| CO₂-Einsparung (Stahl) | 28 Tonnen pro Tonne H₂ |
Trotz dieser Pläne hinkt Deutschland hinterher: Aktuell sind erst 0,55 GW Elektrolyseleistung finanziert, und nur 0,1 GW sind in Betrieb. Um das 10-GW-Ziel zu erreichen, müsste jährlich 1–2 GW neu installiert werden – eine Herkulesaufgabe.
Grüner Wasserstoff: Wo steht die Produktion?
Grüner Wasserstoff entsteht durch Elektrolyse von Wasser mit Ökostrom. Doch die Produktion in Deutschland ist noch minimal:
- 2023 wurden nur 3,036 Mrd. Kubikmeter Wasserstoff hergestellt – tendenziell rückläufig seit 2008.
- Die Kosten liegen mit 4–6 €/kg deutlich über denen von grauem Wasserstoff (1,50–2,50 €/kg).
Tabelle 2: Wasserstoffproduktion in Deutschland
| Jahr | Produktion (Mrd. m³) |
| 2008 | 5,2 |
| 2023 | 3,0 |
Projekte wie GET H2 in Nordwestdeutschland zeigen Fortschritte: Bis 2026 entsteht ein Netz aus Elektrolyseuren, Kavernenspeichern und umgerüsteten Gasleitungen, das Industriezentren wie Salzgitter versorgen soll.
Infrastruktur: Das Wasserstoff-Kernnetz
Ein Meilenstein ist das Wasserstoff-Kernnetz, das 2025 schrittweise in Betrieb geht:
- 9.700 km Pipelines, davon 60 % umgerüstete Erdgasleitungen.
- 13 Grenzübergänge für Importe aus Europa.
- Anbindung an Speicher wie den Kavernenspeicher Epe (70 Mio. m³ Kapazität).
Tabelle 3: Wichtige Infrastrukturprojekte
| Projekt | Region | Ziel |
| GET H2 | Nordwest | Industrieversorgung ab 2024 |
| Doing Hydrogen | Ostdeutschland | Wasserstoff-Hub ab 2026 |
| Kernnetz | Bundesweit | EU-weite Vernetzung ab 2025 |
Doch Kritiker bemängeln fehlende Betreiber für viele Pipeline-Abschnitte und unklare Finanzierungsmodelle.
Internationale Kooperationen: Importe als Schlüssel
Da Deutschland nur begrenzt Ökostrom für die Eigenproduktion hat, setzt es stark auf Importe. Potenzielle Partnerländer sind:
- Marokko und Kanada (Wind- und Solarpotenzial).
- Norwegen (Pipeline-Anbindung geplant).
Laut Studie HYPAT könnte grüner Wasserstoff bis 2050 20 % des deutschen Energiebedarfs decken – vorausgesetzt, die globale Lieferkette funktioniert.
Tabelle 4: Mögliche Wasserstoff-Exportländer
| Land | Stärken | Herausforderungen |
| Marokko | Hohe Solarerträge | Politische Instabilität |
| Kanada | Günstige Windenergie | Lange Transportwege |
| Brasilien | Biomasse-Ressourcen | Abholzungsrisiken |
Herausforderungen: Kosten, Infrastruktur, Politik
Trotz Fortschritten gibt es Hürden:
- Hohe Produktionskosten: Grüner Wasserstoff ist ohne Subventionen nicht wettbewerbsfähig.
- Fehlende Infrastruktur: Kavernenspeicher und Pipelines sind noch im Aufbau.
- Politische Unsicherheit: Lange Genehmigungsverfahren bremsen Investitionen.
Die Industrie fordert „Carbon Contracts for Difference“, um Preisdifferenzen zu fossilen Energien auszugleichen.
Ausblick: Innovationen und globale Vernetzung
Langfristig könnte Deutschland durch folgende Schritte zum Wasserstoff-Vorreiter werden:
- Technologieführerschaft in Elektrolyseuren und Speicherlösungen.
- Europäische Zusammenarbeit, z. B. durch das EU-weite Wasserstoffnetz.
- Faire Partnerschaften mit Exportländern, um Nachhaltigkeit zu garantieren.
Fazit
Grüner Wasserstoff ist kein Allheilmittel, aber unverzichtbar für die CO₂-Neutralität. Deutschland hat mit seiner Strategie und Infrastrukturprojekten Grundsteine gelegt – nun muss die Umsetzung beschleunigt werden. Gelingt dies, könnte die Wasserstoffwirtschaft nicht nur das Klima schützen, sondern auch neue industrielle Wertschöpfungsketten schaffen.